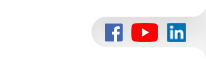Gesundheit & Medizin
Palliative Versorgung im Altenheim
Coming-out mit HIV
Vater stirbt
Geburtsangst
Alkohol in der Schwangerschaft
Studie zu Unfällen mit Fußgängern
Eigensinn und Frauen-Zimmer
Menschenrechte
Die Hinrichtung
Rückkehr ins Leben
Partisanin gegen Lynchjustiz
Albtraum, lebenslänglich
Dorothee Frank: Menschen töten
Victim Impact Statement
Amanda Eyre Ward: Die Träumenden
Zu arm für einen guten Verteidiger
Die Mörderin, das Biest
Einsame Rufer?
Man wollte sie hinrichten
Leben ohne Papiere
Victim Impact Statement
Strafe soll dem Täter Rehabilitation ermöglichen, andere Täter abschrecken und die Gesellschaft sicherer machen. Strafe soll den Opfern gerecht werden, der Täter soll sühnen um den (überlebenden) Opfern „closure“, „heilung“ zu bringen.
Wie sich das Strafverständnis in den letzten Jahrzehnten gewandelt hat und welche veränderte Rolle die Hinterbliebenen von Mordopfern in Todesstrafprozessen spielen, das möchte dieser Artikel untersuchen. Zentraler Untersuchungsgegenstand ist das victim impact statement, die Aussage von Hinterbliebenen der Mordopfer, in der Straffindungsphase des Prozesses nach einem Schuldspruch in den USA.
Diese werden in ihrer juristischen Geschichte betrachtet und zudem in ihren Kontext eingebettet: wie wird Strafe gesellschaftlich bewertet. Dabei werde ich auch auf Strafvorstellungen in Deutschland zurückgreifen. Unterschiedliche Einstellungen von Mordopferhinterbliebenen zur Todesstrafe und ihre Auswirkungen auf Prozesse und Strafverständnis werden beleuchtet und auch die Rolle der Jury, die Auswirkungen der victim impact statements auf ihr Urteil, kurz dargestellt.
In Todesstrafenprozessen in den USA ruft die Staatsanwaltschaft inzwischen fast immer Hinterbliebene der Mordopfer als Zeugen aus – auch, wenn sie zum Tatgeschehen nichts zu sagen haben. So sagten im Prozess gegen Timothy McVeigh, der im April 1995 ein öffentliches Gebäude in Oklahoma in die Luft gesprengt hatte, eine Tat, bei der 168 Menschen getötet wurden, diverse Angehörige aus. Glenn A. Seidl berichtete über den Tod seiner Frau, die in dem Gebäude gearbeitet hatte und wie schwer es für ihn sei, mit der Trauer seines neun Jahre alten Sohnes umzugehen, der laufend nach der Mutter frage und sie schrecklich vermisse. Er konnte vor Gericht auch einen Brief des Sohnes vorlesen: „I miss my Mom, we used to go for walks. She would read to me. We would go to Wal-Mart… Sometimes at school around the holidays I will still make my Mother’s Day and Valentine’s Day cards like the other kids.“ (Sarat, S.9)
Glenn A. Seidl war nur der letzte von 26 Mordopferangehörigen, die die Staatsanwaltschaft in den Zeugenstand rief, neben drei verletzten Überlebenden und acht Angehörigen der Rettungskräfte. Ziel war es laut Staatsanwalt, den Mitgliedern der Jury klarzumachen dass es nicht einfach Massenmord war: „There are 168 people, all unique, all individual…. All had families, all had friends, and they’re different.“ (Sarat S.8)
Die Geschichte des victim impact statements
Die Rolle von victim impact statements hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte geändert – einschneidend ist das Jahr 1991 mit der Entscheidung des US Supreme Court Payne v. Tennessee.
1976 hatte das US Supreme Court die Todesstrafe wieder zugelassen und u.a. angemahnt, dass es „desirable for the jury (is) to have as much information as possible when it makes the sentencing decision.“ 1977 entschied dasselbe Gericht im Falle Gardner v. Florida “it is of vital importance to the defendant and to the community that any decision to impose the death sentence be, and appear to be, based on reason rather than emotion.”
1982 wird unter der Reagon Administration ein Report veröffentlicht, der dem wachsenden “victim rights movement” Rechnung trägt. Darin wird nicht nur Beratung und Therapie für Verbrechensopfer und finanzielle Unterstützung angemahnt, sondern unter Punkt 6: „Judges should allow for, and give appropriate weight to, input at sentencing from victims of violent crime“.
1997 unterschreibt Clinton den Victim Rights Clarification Act, der es Verbrechensopfern erlaubt auch dann am Prozess des Angeklagten als Zuschauer teilzunehmen, wenn sie selbst ein victim impact statement abgeben.
Zwischen diesen beiden politischen Entscheidungen liegt eine fundamentale Veränderung der Einschätzung von victim impact statements in der Straffindungsphase von Todesstrafenprozessen durch das US Supreme Court.
1987 entschied das Gericht in Booth v. Maryland (Booth wurde zum Tode verurteilt für den Mord an einem Ehepaar) dass victim impact statements gegen die Verfassung verstoßen. In der Straffindungsphase des Prozesses nach dem Schuldspruch verlas die Staatsanwaltschaft ein victim impact statement von Sohn, Tochter, Schwiegersohn und Enkelin. Darin beschrieb der Sohn seine Depressionen und die Tochter, wie sie bei jedem Anblick eines Messers an den Tod ihrer Eltern denken müsse (diese wurden erstochen) und dass Booth sich niemals rehabilitieren würde.
In einer 5-4 Entscheidung hob der US Supreme Court diese Strafe auf, weil victim impact statement in einem Todesstrafenprozess wie ein „Mini-Gericht“ über den Charakter der Opfer sei und die Jury davon abhalte, sich, wie von der Verfassung vorgesehen, auf die Beweise zu konzentrieren die sich auf das Verbrechen beziehen und auf den Angeklagten als „uniquely individual human being.“ Emotionale Urteile trauernder Menschen könnten die Jury nur emotional beeinflussen.
Deutlich sagte das Gericht, dass „the Eighth Amendment prohibits a capital sentencing jury from considering victim impact evidence“. Dieser Verfassungzusatz verbietet eine grausame und ungewöhniche Bestrafung.
Dennoch wurden victim impact statements weiter von Staatsanwälten in Todesstrafenprozessen eingesetzt und einige Berufungsgerichte gaben dem statt.
So musste der US Supreme Court 1989 in South Carolina v. Gathers wieder über die Zulässigkeit von victim impact statements entscheiden. Diesmal hatte der Staatsanwalt der Jury im ursprünglichen Verfahren erklärt, dass das Opfer sehr religiös und ein nützliches und geachtetes Mitglied der Gemeinde gewesen sei, engagiert zudem für die Gemeinschaft weil er in der Hand noch seine Wähler-Registrierungskarte hielt, als er ermordet aufgefunden wurde. Schon der Supreme Court of South Carolina hatte die Strafzumessung aufgehoben, weil dieses statement der Jury suggeriert hätte, Gathers verdiene die Todesstrafe weil sein Opfer religiös und ein registrierte Wähler war. Dies bestätigte der US Supreme Court in einer weiteren 5-4 Entscheidung und ergänzte, dass die Einlassungen zum Opfer keinerlei Bezug zur Verantwortung des Täters habe und Faktoren enthalte, die der Täter nicht gewusst habe und die für seine Entscheidung, zu töten, keine Rolle gespielt hätten.
Trotzdem fuhren untere Gerichte fort, victim impact statements zuzulassen und unterminierten damit die Entscheidung des US Supreme Court massiv.
In der Zwischenzeit wurden zwei Richter am US Supreme Court pensioniert, Powell 1987 und Brennan 1990, ihre Nachfolger wurden Richter Kennedy und Richter Souter. Damit war auch eine Veränderung in der Mehrheitsbetrachtung des victim rights movement vollzogen.
Und der Weg wurde frei für Payne v. Tennesse.
1987 hatte Pervis Tyrone Payne eine Nachbarin seiner Freundin im Kokain– und Alkoholrausch erstochen, nachdem diese sich seinen sexuellen Annäherungen widersetzt hatte, zudem erstach er ihre zweijährige Tochter, der dreijährige Sohn überlebte schwerste Stichwunden.
Nach dem Schuldspruch rief die Staatsanwaltschaft in der Straffindungsphase die Mutter der Ermordeten als Zeugin auf, die die Auswirkung der Tat auf ihren überlebenden Enkel beschrieb. „He cries for his mom. He doesn’t seem to understand why she doesn’t come home. And he cries for his sister Lacie.” Der Staatsanwalt ging in seinem Schlussplädoyer eindringlich auf die Auswirkungen der Tat auf den überlebenden Enkel ein, der die Tat mit angesehen hatte. Zudem beschwörte er Lacie in den Gerichtssaal: „No one will ever know about Lacie Jo because she never had the chance to grow up.(…) So, no there won’t be a high school principal to talk about Lacie Jo Christopher, and there won’t be anyone to take her to the high school prom. (…)”
Der Tennesse Supreme Court bestätigte das Urteil trotz des victim impact statements – und der US Supreme Court diesmal auch, mit 6-3 Stimmen. Der Schmerz und Schaden, der durch das Verbrechen entsteht, sei relevant für die Strafmaßfindung und victim impact statements seien „simply another form or method for informing the sentencing authority about the specific harm caused by the crime in question.“
Für die Ausgewogenheit im Prozess sei es zudem wichtig, dass nicht nur der Angeklagte mildernde Umstände vorbringen dürfe, sondern auch die Staatsanwaltschaft Beweise für den guten Charakter des Opfers und den Schaden, den die Mordopferangehörigen erleiden mussten.
Die Feststellung desselben Gerichts im Falle Booth, nur vier Jahre vorher getroffen, dass victim impact evidence die Jury ermutigen würde, höhere und härtere Strafen zu verhängen, wenn das Opfer ein angesehener Bürger gewesen war als wenn es ein als nicht so wertvoller Bürger betrachtet würde, wurde nun von der Mehrheit der Richter schlicht für falsch befunden.
Einen weiteren Höhepunkt erreichte die Zulassung von victim impact statement in United States v. McVeigh. Wie schon beschrieben, wurde nicht nur eine große Zahl von Opfer-Zeugen aufgerufen, darunter waren auch einige Angehörige der Rettungskräfte, die unzweifelhaft traumatische Ereignisse verarbeiten mussten – wie ein Officer, der nur noch die Hand einer eingeklemmten sterbenden Frau halten konnte, die nicht schnell genug befreit werden konnte. Doch unterscheiden sich diese, in Ausübung ihres Berufes erlebten Schrecken kaum von denen vergleichbarer Ereignisse, die durch einen Unfall oder ein Naturereignis ausgelöst werden.
McVeigh war ein Höhepunkt der victim rights Bewegung, denn wer diesen Mann nicht tot sehen wollte riskierte sofort den Vorwurf, die Opfer nicht zu würdigen.
Präsident Clinton kommentierte das Todesurteil umgehend als: „long overdue day for the survivors and the families of those who died in Oklahoma City.“ (Sarat S. 7) In Oklahoma City läuteten nach der Urteilsverkündung Kirchenglocken.
Was ist Strafe?
Mord ist eine Straftat, bei der es Täter und Opfer gibt. (Dies mag banal klingen, sei hier aber erwähnt, weil z.B. bei Steuerhinterziehung ein direkt geschädigtes Opfer durchaus schwer auszumachen sein kann.) Dass der Mord auch die überlebenden Angehörigen und Freundinnen/ Freunde schädigt, ist offensichtlich. Als Argument für die Todesstrafe wird oft „closure“ für diese Überlebenden genannt, neben „Abschreckung“ und „Vergeltung“.
Die Angehörigen werden in den Strafprozess auch bei der Findung des Strafmaßes verstärkt von der Staatsanwaltschaft einbezogen wie wir gesehen haben. Die Justiz bleibt aber als die einzige Instanz, die Recht sprechen kann, bestehen, es gibt keine direkten Rechte der Opfer, das Strafmaß zu bestimmen oder gar auszuführen.
Ich trete an dieser Stelle einen Schritt zurück und analysiere, was Strafe sein kann und was Strafe für einen Stellenwert in unserer Gesellschaft hat (damit beziehe ich mich zunächst auf Deutschland). Inwieweit dieses Strafverständnis in den USA anders ist, wird sich anschließen, und ich werde damit zum Ausgangspunkt, dem victim impact statement, zurückkommen und welches Strafverständnis diesem (nicht) zugrunde liegt.
Strafe: Anerkennung der Tat als Unrecht
Ich werde die Geschichte des Strafrechts nicht im Detail aufzeigen (siehe dazu Foucault/ Hassemer/ Reemtsma), für die Herausbildung unseres heutigen Justizapparates sei nur soviel gesagt, dass sich die Justiz als Mediator zwischen Täter und Opfer im Zivilisationsprozess herausgebildet hat. Der Staat sagt durch einen Gesetzeskanon so weit wie möglich präzis und verbindlich voraus, welche Sanktionen er für welche Taten unter welchen Umständen einsetzen wird und verpflichtet sich, seine Macht darauf zu begrenzen. Die Anerkennung der Straftat durch die Justiz als Unrecht soll mögliche Rachebedürfnisse der Opfer dabei bändigen bzw. in „kundige Hände“ legen. (Hassemer/ Reemtsma S. 20)
Eine Straftat, bleiben wir bei Mord, erschüttert das Empfinden „dass ich mir keine Gedanken machen muss“. Rechtssprechung kann keine durch das Verbrechen ausgelösten Traumata heilen – und hat auch gar nicht diesen Anspruch, aber kann dem Opfer etwas anderes geben, es „ist die Erneuerung der Zusage, sich bestimmte Gedanken nicht machen zu müssen. Ob es (das Opfer S.V.) selber in der Lage sein wird, sie sich tatsächlich nicht zu machen, steht auf einem anderen Blatt und hat mit Fragen der Rechtsfindung nichts zu tun.“ (Hassemer/ Reemtsma S. 135)
Dieses Argument ist einleuchtend, wenn man sich z.B. den Kampf von Feministinnen um die rechtliche Anerkennung der Strafbestände Vergewaltigung in der Ehe und Vergewaltigung als Kriegsverbrechen vor den Internationalen Strafgerichtshöfen in Den Haag und Ruanda ansieht: Es dauerte lange, bis sich die Argumente der feministischen Juristinnen und Aktionistinnen durchsetzten. Die Anerkennung, dass in beiden Fällen überhaupt ein Verbrechen stattgefunden hat, ist für die Opfer die Vorraussetzung dafür, die (traumatisierende) Erfahrung bestmöglich ist das eigene Leben zu integrieren – die Wege hierzu sind dabei individuell unterschiedliche und auch unterschiedlich erfolgreich.
Die Anerkennung der Vergewaltigung als solche mit den Folgen der Verfolgung des Täters ist notwendig, aber nicht hinreichend zur Bewältigung der Schäden für das Opfer.
Somit spiegelt das Strafgesetzbuch mit seinen „anerkannten“ Taten und den Höhen der Strafen auch die gesellschaftliche Stimmung wieder, die die vorherrschende ist.
Anders als die Anerkennung als Straftat ist das Strafmaß aber verstärkt verschiedenen Wahrnehmungen ausgesetzt – denn hier stellt sich eine Frage, die heute durchaus meist als eine Entweder-Oder-Frage begriffen wird: Ist Strafe für den Täter oder für das Opfer da?
Täterorientierung von Strafe
1976 trat ein neues Strafvollzugsgesetz in der Bundesrepublik Deutschland in Kraft, es war die Folge langer Diskussionen über die Grundrechte von Strafgefangenen. Die Grenzen lebenslanger Freiheitsstrafen wurden am 21. Juni 1977 zudem vom Bundesverfassungsgericht bestätigt, welches urteilte, „dass ein menschenwürdiger Vollzug der lebenslangen Freiheitsstrafe nur dann sichergestellt ist, wenn der Verurteilte eine konkrete und grundsätzlich auch realisierbare Chance hat, zu einem späteren Zeitpunkt die Freiheit wiedergewinnen zu können; denn der Kern der Menschenwürde wird getroffen, wenn der Verurteilte ungeachtet der Entwicklung seiner Persönlichkeit jegliche Hoffnung, seine Freiheit wiederzuerlangen, aufgeben muss.“
Die Intention dieses Gesetzes und der juristischen wissenschaftlichen Auseinandersetzungen ist nach Hassemer „die Täterorientierung sämtlich im Interesse eines zurückhaltenden, gerechten Strafrechts.“ (Hassemer/ Reemtsma S. 57). Er nennt u.a. die Stellung des Beschuldigten als Subjekt im Strafprozess und das Recht auf Verteidigung als zentrale Themen, die dem Strafvollzuggesetz zugrunde liegen. Er sieht im modernen Strafrecht eine Ausrichtung über Vergeltung hinaus: „Während Vergeltung und Sühne ein eher normatives und auf das forum internum des Menschen konzentriertes Phänomen sind, arbeiten Besserung und Abschreckung auch an der Außenhaut. Sie nehmen den verurteilten (Besserung) und den virtuellen (Abschreckung) Straftäter ins Visier und in die kalkulierende Vernunft, und sie versprechen, die Strafe und ihr Vollzug am Täter würden die Welt real verbessern. Eine strengere Täterorientierung lässt sich kaum ausdenken.“ (ebenda)
Eine „besondere Schwere der Schuld“ erlaubt dabei keine vorzeitige Entlassung des Täters nach 15 Jahren, die Haftdauer verlängert sich dadurch im Durchschnitt auf zur Zeit 17 bis 23 Jahre. (Zur Orientierung: Laut Statistischem Bundesamt waren in 2003 2080 zu lebenslanger Haft verurteilte Personen in deutschen Gefängnissen).
Ende des 20. Jahrhunderts hat sich die Sicht auf den Täter schnell und radikal verändert (dies ist in Deutschland parallel zu den USA zu beobachten). Dabei ist er nicht etwa nur weniger im Mittelpunkt: „Trat der Täter bislang insbesondere als Träger verletzbarer Grundrechte auf, so trägt er nun das Kleid des Bedrohers und Verletzers.“ (Hassemer/ Reemtsma S. 58). Dies ist Folge davon, dass das Opfer mehr in den Mittelpunkt des Interesses trifft. Es ist nur Opfer aufgrund der Tat des Täters, der nun mehr weniger selbst als potenzielles Opfer staatlicher Strafmacht wirkt.
Waren in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Bemühungen, den Täter zurück in die Gesellschaft zu holen, maßgeblich für das Rechtsempfinden, ist es inzwischen gerade der Versuch, die Täter auszugrenzen, der als angemessen für die Opfer propagiert wird. Dies ist auch ein emotionaler Prozess, der Empathie für den Täter als Mitleidlosigkeit gegenüber den Opfern deutet und schließlich im victim impact statement mündet als Argument für eine härtere Strafe.
Die Karriere des Opfers
Mit den Opfern von Gewalt(verbrechen) konfrontiert zu werden heißt auch, mit den eigenen Ängsten und Verletzlichkeiten konfrontiert zu werden. Das Opfer eines Gewaltverbrechens war ganz dem Willen eines Anderen unterworfen, diese Vorstellung ist eine extrem unangenehme und vermutlich auch deshalb wird Opfern (und Angehörigen von Opfern) nach einiger Zeit der Empörung über das erlittene Unrecht und den Verlust und der Wut auf den Täter meist signalisiert: „nun ist es aber gut“. Die Toleranz der Umwelt gegenüber Trauer und Schmerz nimmt mit der Zeit ab, noch schneller in der allgemeinen Öffentlichkeit, die bereits die Schlagzeilen der nächsten Katastrophe oder des nächsten Verbrechens konsumiert.
Die Umwertung der Opferrolle ist laut Reemtsma „als Reaktionsbildung auf die Zivilisationskatastrophe des Holocaust, also den zu großen Teilen erfolgreichen deutschen Versuch, die Juden Europas umzubringen, (zu) verstehen.“ (Hassemer/ Reemtsma S. 42) Er nennt es „moralische Aktzeptanz“, die den Berichten der Opfer entgegengebracht werden. Es ist gleichsam ein Versuch, die Welt durch die Augen des Opfers zu sehen und so der Versuch, diesem ein Stück seiner Würde wiederzugeben, ihm (ihr) aus dem Opferstatus zu einem neuen Subjektstatus zu verhelfen. (Denn wie Reemtsma zu Recht anmerkt, kann die Opferliteratur keine Lektion erteilen die wir nicht schon kennen würden: Dass Menschen Menschen so etwas nicht antun dürf(t)en.)
Die neue Sicht auf das Opfer verändert auch Diskussionen um Strafe. Deutliches Beispiel ist die Veränderung der Wahrnehmung – und Bestrafung – von Vergewaltigung und sexuellem Missbrauch, nachdem durch die Frauenbewegung Opfer dieser Straftaten eine Stimme bekamen bzw. diese selbst erhoben. „Zeugnis ablegen“ und „Gehör finden“ sind zu Recht anerkannt als Teil einer Verarbeitung des Erlebten, der Unterwerfung unter den fremden Willen. Sie sind eine Vorraussetzung, mit dem Erfahrenen/ dem Verlust leben zu können.
Zeugnis ablegen kann auch ein victim-impact-statement vor Gericht. Allerdings, so behaupte ich, ist das Rufen nach harter Strafe „für die Opfer“ wiederum nur der Versuch, die eigenen Gefühle von Angst, Verletzlichkeit und Ohnmacht als Zuhörerin/ Zuhörer in geregelte Bahnen zu bringen. Die Illusion einer Welt, in der wir gute und böse Menschen „sauber“ unterscheiden und selektieren können soll so (wieder)hergestellt werden.
„Eine gerechte Strafe wird es nicht geben“ sagte die Mutter der ermordeten Levke vor Gericht. (Süddeutsche Zeitung 11. Mai 2005) Sie war als Zeugin aufgerufen, nicht weil sie etwas zur Straftat sagen konnte, sondern um Zeugnis abzulegen für Levke und v.a. für den Verlust, mit dem sie und der Rest der Familie leben müssen. Der Artikel in der Süddeutschen Zeitung vermerkt: „Der Atmosphäre des Gerichtssaals und den strengen Formalitäten des Verhandlungsablaufs sind Emotionen nicht zuträglich, und die Opfer einer Tat werden in der Regel nicht ermutigt, ihre Gefühle zu zeigen“ Und nach der Aussage der Mutter:“… gab es keine unbeteiligten Beobachter mehr im Saal. Es gab nur noch mitfühlende Menschen, viele hatten Tränen in den Augen.“
Levkes Mutter sagte aber auch, dass ihr egal ist, wie hoch die Strafe ausfällt: „Eine gerechte Strafe wird es nicht geben, denn er lebt weiter und sie nicht“. (Der geständige Marcus H. wurde im Juni 2005 zu lebenslanger Haft und anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt.)
In diesem Satz stecken die Grenzen der Empathie für die Opfer, gerade die Mordopferangehörigen, und der Möglichkeiten, ihnen mit Hilfe einer hohen Strafe, auch der Todesstrafe, zu helfen: Sie lebt nicht mehr, das ist unwiderruflich.
Dabei können Rachewünsche der Opfer durchaus positiv gedeutet werden: „Wer Rachewünsche hegt, will dadurch denjenigen, der ihn zum Objekt fremder Absichten gemacht hat, seinerseits zum Objekt machen und die eigenen Subjektivität so wiedergewinnen.“ (Hassemer/ Reemtsa S.123) Täter und Opfer werden so durch die Rache(Phantasien) wieder Gleiche. Reemtsa sieht dies allerdings nicht als zwangsläufig, sondern als Möglichkeit, denn: “Nun gibt es genug Menschen, die kein Bedürfnis nach einer solchen Wiederherstellung von Gleichheit haben – meistens vermutlich deshalb, weil mit ihr auch der Unterschied von Recht und Unrecht nivelliert wird.“
Die Wiederherstellung der „Gleichheit“ scheint bei einem Mord konse-quenterweise die Todesstrafe. Mit der gestiegenen Bedeutung der victim impact statement und auch von Aussagen wie der von Clinton beim Todesurteil für Timothy McVeigh als „Gerechtigkeit für die Opfer“ wird der Rachegedanke zur Grundlage des Strafmaßes – nicht Abschreckung und nicht Rehabilitation. Der Staat wird mit der Verheißung der Todesstrafe als „Heilung für die Opfer“ zum stellvertretenden Rächer. Private Rachephantasien werden im Recht legitimiert, die Trennung von privatem Wunsch und öffentlichem Recht verschwimmt.
Hier sei noch einmal Reemtsma zitiert: „Die Vorstellung, der Staat können stellvertretend Rache üben, hat mit der weitverbreiteten Vorstellung zu tun, jedermann könne das. Wer Opfer eines Verbrechens geworden ist, erlebt oft, dass seine Mitmenschen irgendeine Form von Gemeinschaft mit ihm stiften wollen, indem sie ihn Phantasien von stellvertretender Rache aussetzen: ‚Also wenn ich den in die Finger bekäme…!’(…) Ich habe in solchen Phantasien immer ‚die Gegenseite’ erlebt, denjenigen, der seiner Aggressivität, manchmal sogar Bosheit, freien Lauf lässt, wenn ihm eine scheinbar moralisch einwandfreie Gelegenheit dazu geboten wird.“ (Hassemer/ Reemtsma S. 126)
Dazu zwei Anmerkungen: Die Aussage von Reemtsma ist in sofern eine dankbare, da er, der selbst Opfer einer Entführung geworden ist, einem anderen ‚scheinbar moralisch einwandfreiem Vorwurf’ nicht ausgesetzt werden kann: Selbst nie das Leid der Opfer erlebt zu haben und dann noch deren Wunsch nach Rache/ Todesstrafe zu wiedersprechen. Dabei wird meist übersehen, dass die, die diesen Vorwurf machen, oft selbst keine Opfer sind (z.B: die Staatsanwälte). Wichtiger noch erscheint mir, dass man diesem Argument nur folgen kann, wenn man Betroffene in allen ihren Belangen zu den einzigen Experten erklärt, was etwas ganz anderes als ihnen angemessenes Gehör bei sie betreffenden Entscheidungen zu geben. In Konsequenz macht der Maulkorb „nicht-Opfern“ gegenüber letztlich jede parlamentarische Demokratie unmöglich, in der Stellvertreterinnen und Stellvertreter täglich über Dinge entscheiden, von denen sie nicht unmittelbar betroffen sind, dies aber im Namen ihrer Wählerinnen und Wähler und damit auch Betroffener, tun.
Die zweite Anmerkung zu dem Zitat betrifft die Mitmenschen: Der Wunsch nach Ausgleich kann m.E. auch der nach einer sicheren Welt sein, in der Mord mit den Mördern aussortiert werden kann. Der Wunsch, gute und böse Menschen trennen zu können und die Bösen – und damit das Böse – einfach eliminieren zu können. (Dass diese Vorstellung von Selektion und Eliminierung in Terror und Diktatur führt zeigt nicht nur die deutsche Geschichte des Nationalsozialismus.)
Der Ruf nach Todesstrafe benutzt und verstärkt dieses Angebot an die Mitmenschen, sich zudem noch als auf der „richtigen, der guten“ Seite stehend empfinden zu können.
Diese Art von Populismus wird schließlich genutzt, um politisch mit dem Ruf nach härteren Strafen zu punkten, bestes Beispiel sind die Vergewaltigung von Kindern außerhalb der Familie: Ein Delikt, welches sinkende Fallzahlen haben, während in der Öffentlichkeit (nicht zuletzt durch verstärkte Berichterstattung) der Eindruck entstanden ist, das genau das Gegenteil der Fall ist und der Ruf nach verstärkter Sicherheitsverwahrung somit in den letzten Jahren populärer geworden ist. (Hassemer/ Reemtsma S. 203)
Familienangehörige für Versöhnung
„Murder Victims’ Families for Reconciliation“ – Mordopfer für Versöhnung – heißt ein kleiner Verein indem Familienangehörige von Mordopfern und Familienangehörige von Todestraktinsassen zusammenarbeiten. Zur gegenseitigen Unterstützung und gegen die Todesstrafe.
Carol Byars habe ich im September 2000 auf ihrer Arbeitsstelle, einem kleinen Cafe in der Nähe von Houston, getroffen. Hier verdient sie sich ihren Lebensunterhalt als Kellnerin. Ihr Mann wurde vor 20 Jahren ermordet. Sie wollte nicht dass der Mörder hingerichtet wird – im Gesicht der Ehefrau des Mörders im Gerichtssaal sah sie den selben Schmerz wie in ihrem eigenen Gesicht jeden Morgen im Spiegel. Sie wurde zur Gegnerin der Todesstrafe. Viele ihrer Bekannten konnten das nicht verstehen: „Du musst deinen Mann nicht richtig geliebt haben wenn du seinen Mörder nicht tot sehen willst!“ Ihren Lebensmut, auch ihre wiedergefundene Lebensfreude bezieht sie aus der Kraft der Versöhnung wie sie sagt. Eine Unterstützung hat sie von der Justiz nicht erhalten.
Leben mit dem Schmerz und Verlust, Heilung, wie es viele nennen, glauben die Mitglieder von „Murder Victims’ Families for Reconcilation“ nur durch Vergeben, nicht durch Vergeltung finden zu können. Darüber hinaus arbeitet die Organisation daran, Alternativen zur Todesstrafe aufzuzeigen. Sie unterstützen Programme, in denen Gefangene lernen sollen, Konflikte gewaltfrei zu lösen und arbeiten als Lobbygruppe daran, dass Gesetzgeber und Staatsanwälte Wiedergutmachung und Resozialisierung an die Stelle von Vergeltung im Strafsystem setzen.
Dabei spielt Vergebung, „Forgiveness“ eine ähnliche Rolle wie der Ruf nach Rache und Tod: Die aktive Entscheidung, dem Mörder/ der Mörderin zu vergeben, lässt die Hinterbliebenen sich selbst als Subjekte erleben und nicht mehr dem Täter/ der Täterin ausgeliefert, denn diese Entscheidung ist allein die ihrige.
Rachel King, die ein Buch über „Murder victims for Reconcilation“ geschrieben hat, drückt es so aus: „The irony of forgiveness is that while it appears to be a selfless act, it is really a very selfish one. People who are unable to forgive cling to their bitterness und rage and are therefore doubly wounded by the killer, who has taken away not only their loved one but also any chance of enjoying their own life. As Bill Pelke says of the girl who killed his grandmother, ‘Forgiving Paula Cooper did a lot more for me than it did for Paula Cooper.’” (King S. 8)
Exkurs zur menschlichen Fähigkeit zu verzeihen
Die Philosophin Hannah Arendt sieht die Fähigkeit zu verzeihen als Grundlage, die menschliches Handeln überhaupt erst möglich macht. Sie sieht menschliches Handeln als „die Fähigkeit, das zu tun, was die naturwissenschaftliche ‚Forschung’ heute täglich tut, nämlich Vorgänge zu veranlassen, deren Ende ungewiß und unabsehbar ist.“ (Arendt S. 226) Was wir tun, ist irreversibel sobald es getan ist: „Und dieser Unfähigkeit, Getanes ungeschehen zu machen, entspricht eine fast ebenso große Unfähigkeit, seine Folgen vorauszusehen oder seine Motive verlässlich zu ergründen.“ (Arendt S. 228) Um unter diesen Umständen überhaupt handlungsfähig zu bleiben, so Arendt, brauchen die Menschen die Fähigkeit, verzeihen zu können, angesichts dieser Ungewissheit der Folgen unserer Taten brauchen wir zudem die Fähigkeit, Versprechen zu geben: „Das Heilmittel gegen Unwiderruflichkeit – dagegen, dass man Getanes nicht rückgängig machen kann, obwohl man nicht wusste und nicht wissen konnte, was man tat – liegt in der menschlichen Fähigkeit zu verzeihen. Und das Heilmittel gegen Unabsehbarkeit – und damit gegen die chaotische Ungewissheit alles Zukünftigen – liegt in dem Vermögen, Versprechen zu geben und zu halten.“ (Arendt S. 231) „Könnten wir einander nicht vergeben, d.h. uns gegenseitig von den Folgen unserer Taten wieder entbinden, so beschränkte sich unsere Fähigkeit zu handeln gewissermaßen auf eine einzige Tat, deren Folgen uns bis an unser Lebensende im wahrsten Sinne des Wortes verfolgen würden.“ (Arendt S. 232)
Arendts Versprechen finden wir in Verfassung und Gesetzesbüchern: Da die Zukunft trotzdem ungewiss bleibt, Verbrecher Versprechen brechen, kann Strafe das brüchig gewordene Versprechen einer gewissen Zukunft wieder herstellen. Um nach der (Mord)Tat weiter handeln zu können, ist das Verzeihen geradezu pragmatische Notwendigkeit. Todesstrafe verweigert dem Täter diese Maxime menschlichen Handelns.
Auch SuZann Bosler, die einen Überfall schwer überlebte, bei dem ihr Vater von einem Eindringling ermordet wurde und sie selbst niedergestochen und schwer verletzt wurde, gab in der Straffindungsphase des Prozesses gegen den Mörder, James Bernard Campbell, 1988 vor Gericht ein Victim impact statement ab. Dabei bat sie um das Leben des Täters, da sie ihm verziehen habe und auch ihr Vater, so meinte sie, als Christ dasselbe gewollt hätte.
Staatsanwalt Michael Band erklärte der Presse, er werde an der Todesstrafe festhalten, der Staat können nicht so barmherzig sein wie Ms. Bosler. (King S. 147) Diese kommentiert das so: „He didn’t respect what I wanted. Neither did the judge.” (King S. 152)
In einem weiteren Prozess – das erste Strafmaß, Tod, wurde wegen inkorrekter Zeugenbefragung durch die Staatsanwaltschaft aufgehoben, trat SuZann Bosler 1997 als Zeugin der Verteidigung auf. Sie durfte vor Gericht nichts zur Todesstrafe oder dem von ihr gewünschten Strafmaß sagen. Nach dem Urteil der Jury, lebenslänglich, bedankte sie sich: „I can’t thank you enough. I have worked hard for his life to be spared. Now I can go on with my own life. And I thank you very much for that. God bless you all.” (King S. 159)
Die Reaktion der Jury beschreibt King an derselben Stelle so: „Several jurors clutched tissues wet from drying their teary eyes. Some hugged each other. Reporters asked jurors for their opinion on the verdict. One said it was ‘a fair, humane decision.’ Another said that the crime was heinous, but ‘the mitigating factors were strong.’ (Campbell war durch Misshandlungen in der Kindheit schwer geschädigt und galt als geistig zurückgeblieben, S.V.). However, one admitted, ‚If something like that happened to me, I don’t think I could forgive.’”
Der Dank des überlebenden Opfers bestätigt die Jury, das richtige Urteil gefällt zu haben, diesmal gegen die Staatsanwaltschaft.
Noch einen Schritt weiter ging Staatsanwältin Kerry Spears, Milam County in Texas, die den Fall von Ben Contreras vor Gericht vertritt. Dieser wurde angeklagt, den 59jährigen Preston Solomon und dessen 24jährige Stieftochter Stephanie Young erstochen zu haben, ein drittes Opfer überlebte schwer verletzt. Die Staatsanwältin entschied sich dagegen, die Todesstrafe zu fordern: „Anytime we’re talking about plea offers or penalties we consult the victims or their families and give great consideration to their feelings. It’s a fair statement to say that the death penalty is not something the surviving victim and other family members were interested in pursuing.” (Cameron Herald, 28. April 2005) Ob dies wirklich der ausschlaggebende Grund gewesen ist, nicht die Todesstrafe zu fordern, kann an dieser Stelle nicht untersucht werden.
Sicher aber ist meines Erachtens: Der Wille der Opfer darf nicht eine solche Rolle für das Strafmaß spielen, wenn wir die Aufgabe der Justiz darin sehen, übergeordnet zu handeln und mehr zu sein, als ein verlängerter Arm individueller Bedürfnisse, wie immer diese aussehen mögen. Konsequenterweise müssten wir zudem überlegen, ein Gnadenrecht für die Überlebenden einzuführen, möglicherweise ein Recht, finanzielle Entschädigung durch den Täter zu erhalten und dafür Gnade „walten zu lassen“ – ein Gedanke, der in den USA nicht allzu weit entfernt scheint. Dass Gefangene das Recht auf eigenes Geld haben, halten manche Opferverbände für unzumutbar und fordern das Recht auf dieses Geld als Entschädigung für die Opfer.
Opferverbände sehen zudem das victim impact statement durchaus als verlängertes Instrument einer individuellen Rache, die der Staat „für die Opfer“ ausführen soll.
Um dies zu vermeiden, dürfen die Aussagen von Opfern gegen die Todesstrafe bei der Strafmaßfindung keine Rolle spielen sollten.
Wichtig sind sie aber, um das Argument zu entkräften, dass, wer gegen die Todesstrafe sei, automatisch gegen die Opfer sei.
Die Jury
Douglas Mulder war der Staatsanwalt, der 1977 Randall Adams anklagte. Dieser wurde zum Tode verurteilt. Später wurde das Urteil in lebenslänglich umgewandelt, 1989 wurde Adams wegen erwiesener Unschuld aus dem Gefängnis entlassen.
Im Buch über seine Geschichte beschreibt Adams die Reaktion des Staatsanwaltes auf seine Entlassung so: „ Die Aprilausgabe des D Magazine zitierte Mulder: ‚Es ist eine Schande. Aber Admans ist nicht der erste Mörder, der das System überlistet.’ Ein Reporter fragte, wie es ausgesehen hätte, wenn er, Mulder damals im Jahre 1977 nicht der Anklagevertreter sondern mein Verteidiger gewesen wäre. ‚Oh, ja’, erwiderte Mulder. ‚Ich hätte ihn frei bekommen. Daran habe ich nicht den geringsten Zweifel.’“
(Adams/ Hoffer S. 413)
Der Staatsanwalt bringt es auf den Punkt, worauf es vor Gericht im Todesstrafenprozess ankommt: zu gewinnen.
Der „Fall“ eines Menschen wird zum Wettkampf. Extrem deutlich wird dies im „Fall“ Leonel Herrera: Seine Anwälte bekamen eine Aussetzung seiner drei Tage später angesetzten Hinrichtung wegen neuer Beweise für eine mögliche Unschuld ihres Mandanten (neue Zeugenaussagen, u.a. einem Mann, der im Auto zur Tatzeit saß, in dem der Mord geschah!) durch einen Staatsrichter in Texas: „Texas immediately appealed, and the day before Herrera’s execution, as Texas had argued that even assuming Leonel Herrera was innocent, innocence was no basis for granting a writ of habeas corpus. In other words, the court (der fifth Court of Appeals, S.V.) held nothing in the United States Constitution prohibits a state from executing an innocent man as long as his constitutional right to due process was not violated in the course of his trial.“ (Tucker, S. 218) Im Januar 1993 bestätigte der Supreme Court: „The ruling, cited “Herrera vs. Collins“, held that there was no constitutional right to federal relief based on newly discovered evidence of actual innocence, when the defendant’s original trial had been free from procedural error.” (www.minduflly.org/Reform/Leonel-Herrera-Texas12may93.htm) Leonel Herrera wurde im Alter von 45 Jahren am 12. Mai 1993 in Texas hingerichtet, bis heute wurden die starken Beweise für die Täterschaft seines inzwischen verstorbenen Bruders nicht untersucht.
Bleibt man im Wettkampf-Vergleich, sind die Juroren die Preisrichter im Prozess, die entweder Staatsanwaltschaft oder Verteidigung zum Gewinner erklären. Gerade auf die Jury zielt die Staatsanwaltschaft ab, wenn sie victim impact statement einsetzt.
Untersuchungen von Benjamin Fleury-Steiner zeigen, dass die Mitglieder einer Jury da zu neigen, Insider und Outsider zu unterscheiden, auch innerhalb der Jury. Die Entscheidung für ein Strafmaß wird so eine moralische, das Todesurteil unterscheidet moralische Insider von unmoralischen Outsidern. Zweifelnde Jurymitglieder werden unter Druck gesetzt, in dem sie in die Nähe der Outsider gerückt werden. Die Mordopferangehörigen, die ihren Verlust beklagen, gehören zu den Insidern und ein Plädoyer für lebenslänglich gegen den Willen der Staatsanwaltschaft kann ein Jurymitglied somit zu einem outsider machen.
Die Verteidiger mögen versuchen, auch den Angeklagten/ die Angeklagte als menschliches Wesen darzustellen, ihre schwere Kindheit, Depressionen und anderes zur Erklärung der Tat heranziehen („They construct narratives first to humanize their clients and second to connedt their clients’ fates with broader social and political concerns.“ Sarat S. 182) – in einem Klima, in dem eine Hinwendung zum Täter als Person immer schon als Abwendung von den Opfern begriffen wird, hat das zur Zeit nicht viele Chancen.
Literatur:
Adams, Randall/ Hoffer Marilyn/ Hoffer William:
Unschuldig, Bergisch Gladbach 1991
Amerikanisches Original: Adams v. Texas,
1991 St. Martins Press, zitiert wird nach der deutschen Ausgabe
Arendt, Hannah: Vita activa oder vom tätigen Leben, München 4. Auflage 1985
DoDonahoe, Joel F.: The Changing Role of Victim Impact Evidence in Capital Cases, Western Criminology Review 2(1), 1999. Online: http://wcr.sonoma.edu/v2n1/donahoe.html
Fleury-Steiner, Benjamin: Jurors’ stories of Death. How America’s Death Penalty invests in inequality, University of Michigan 2004
Hassemer Winfried/ Reemtsma, Jan Philipp: Verbrechensopfer. Gesetz und Gerechtigkeit, München 2002
King, Rachel: Don’t kill in our names. Families of Murder Victims speak out against the death penalty, Piscataway New Jersey 2003
Sarat, Austin: When the state kills. Capital Punishment and the American Condition, Princeton New Jersey, 3. Auflage 2002
Tucker, John C.: May God have mercy. A true story of crime and punishment, New York 1997
veröffentlicht in: deathrow – Magazin zur Todesstrafe, 04/ 2005