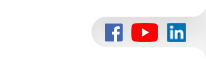Gesundheit & Medizin
Palliative Versorgung im Altenheim
Coming-out mit HIV
Vater stirbt
Geburtsangst
Alkohol in der Schwangerschaft
Studie zu Unfällen mit Fußgängern
Eigensinn und Frauen-Zimmer
Menschenrechte
Die Hinrichtung
Rückkehr ins Leben
Partisanin gegen Lynchjustiz
Albtraum, lebenslänglich
Dorothee Frank: Menschen töten
Victim Impact Statement
Amanda Eyre Ward: Die Träumenden
Zu arm für einen guten Verteidiger
Die Mörderin, das Biest
Einsame Rufer?
Man wollte sie hinrichten
Leben ohne Papiere
Vater stirbt
Sina Vogt beschreibt das Sterben ihres krebskranken Vaters. Ein Erfahrungsbericht aus der Perspektive einer Angehörigen.
Die erste Diagnose „Nierenbeckenkarzinom“ lag eineinhalb Jahre zurück, im Frühling 2002. Mit „Blut im Urin“ hatte er auf sich aufmerksam gemacht, schmerzfrei. Vater trug es mit Fassung. Eine Niere wurde nur Tage später entfernt, bald folgte eine ambulante Chemotherapie. Weiterhin wohnte er allein im Haus, meine Mutter war wenige Jahre vorher gestorben.
Nach der Chemotherapie, die er ohne Haarausfall und mit nur leichten Phasen von Übelkeit überstand kam der Winter, sein Winter, in dem er noch eine große Feier gab für Verwandte und Freunde zu seinem 80sten Geburtstag. Unbemerkt aber wuchsen die Metastasen in ihm und eines Tages schlug es ihm die Beine weg. Das Rückenmark war von Metastasen gequetscht, Querschnittlähmung. Eine OP wurde nicht mehr in Betracht gezogen und das Beste was der behandelnde Arzt tun konnte tat er – eine schnelle Überweisung auf die Palliativstation der Uni-Klinik. Von dort wurde er einige Wochen später zu meiner Schwester entlassen. Seitdem lebte er in diesem Bett in diesem Raum neben dem Wohnzimmer in dieser Familie.
Ich lebte über 450 Kilometer entfernt in Berlin und kam fast jedes Wochenende zu Besuch. Manchmal gingen uns die Gesprächsthemen aus oder er hatte einen müden Tag. Aber miteinander schweigen, das haben wir schon immer gemacht.
Fünf Monate vergingen so.
Eines Tages war ich zu Hause in Berlin und mein Bruder und seine neue Freundin besuchten mich. Die beiden waren auf der Rückreise von einem Kurzurlaub auf Rügen Richtung Köln und wollten das Wochenende bleiben. Ich sah die neue Freundin meines Bruders das erste Mal, beide waren sehr verliebt. Wir saßen noch nicht lange zusammen als meine Schwester anrief: Es geht Vater deutlich schlechter.
Wir fuhren am nächsten Morgen sofort Richtung Köln, ich hatte mich abgemeldet an meinem Arbeitsplatz Unfallkrankenhaus, dann musste die nächste Pressekonferenz eben ohne die Kliniksprecherin über die Bühne gehen.
Abends sitze ich am Bett und halte dem Vater die Hand. Ein Röcheln kommt aus ihm dass den Klang des nahenden Todes hat. Kaum noch reden kann er, aber die Hand hält er fest. Lange sitze ich mit meiner Schwester bei ihm. Sein letzter Tag bricht an. Morgens kommt die Pflegekraft des Palliativpflegedienstes, Frau G.. Sie wäscht ihn und bittet mich, ihn dabei zu halten.
Das erste mal dass ich meinen Vater, der auf der Seite liegt, in den Armen halte während sie seinen Hintern wäscht, die Windel wechselt. Die Ausdünstungen seiner Krankheit sind erträglich, aber der Kotgeruch ist ekelhaft und lässt in mir den Drang wachsen wegzurennen oder mir zumindest die Nase zuzuhalten. Mein Vater schaut mich aus seinen Augen an die tief in den Höhlen liegen. Er jammert leise „au au“. Frau G. spricht mit ruhiger Stimme, immer ihn direkt an. Was sie sagt, klingt liebevoll und aufmerksam, daran erinnere ich mich auch wenn ich die einzelnen Worte nicht mehr weiß.
Ich bin froh dass sie da ist und nicht jemand von der „normalen“ Pflegestation, die mitunter auch kommen da er so lange, über vier Monate, ohne Veränderung lag und der teurere Palliativdienst nicht mehr zwei Besuche jeden Tag vor der Krankenkasse rechtfertigen konnte. Die anderen Pflegkräfte sind freundlich und professionell, aber nur die vom Palliativdienst bauen eine Verbindung auf zum Patienten, kümmern sich um den Menschen und nicht nur um den Hintern. Vielleicht der Unterschied zwischen Beruf und Berufung. Oder Geldverdienen und Leidenschaft.
Vater ist so verletzlich in meinen Armen. Stärker als der Ekel ist die Traurigkeit. Mir stehen Tränen in den Augen und ich spüre den sprichwörtlichen Kloß im Hals. Sage ich etwas? Wenn ja sind die Worte vergessen. Sein Gesicht, sein Blick, sein „au“ sind es nicht.
Das Waschen ist getan, er liegt wieder im Bett. Ich hole mir einen Kaffe, auch ein Grund das Zimmer zu verlassen als Erholung für meine Nase.
Mein Vater hat leise in meinen Armen gejammert. Mein Vater hat nicht mehr die Zähne zusammen gebissen. In seinen letzten Stunden.
Nun liegt er wieder röchelnd auf dem Rücken, den Blick nach oben in eine Weite gerichtet die wir anderen nicht sehen.
Ich sitze stundenlang, wie am Abend zuvor, bei ihm, im Wechsel oder gemeinsam mit meiner Schwester. Wenn ich alleine bin erzähle ich irgendetwas, gemeinsame Erinnerungen oder etwas aus meinem Leben. Oder ich wische seine Stirn ab. Er will kaum noch trinken, warum auch. Zwischendurch halte ich einfach seine Hand und tue das, was ich in allen Lebenslagen tue, ich lese. Einfach das Buch was bei mir gerade dran ist in meinem persönlichen Bücherstapel welchen ich von der einen Seite ablese und von der anderen gleichzeitig ergänze. Jan Philipp Reemtsma, Im Keller.
Meine Schwester kommt auf die Idee, einen Priester zu holen für das Sterbesakrament. Fast fünf Jahre ist es her, da holte mein Vater den Krankenhauspriester an das Bett meiner Mutter, er gab ihr das Sterbesakrament im Beisein meiner Schwester und mir und eine halbe Stunde später hörte ihr Herz auf zu schlagen.
Der Dechant kommt um drei Uhr nachmittags. Meine Schwester, ihre 12jährige Tochter Martha und ich beten mit ihm. Ich bin nicht gläubig aber meine katholische Erziehung lässt mich die Worte des „Vater unser“ erinnern. Martha weint. Meine Schwester und ich weinen auch. Der Dechant bezieht Martha in das Beten mit ein, fragt sie nach ihrem Opa. Der Sterbende liegt da, röchelt, die Augen ins Weite gelenkt oder geschlossen. „Wenn sie soweit sind, dauert es nicht mehr lange, das sagt meine Erfahrung“ sagt der Dechant als er geht.
Meine Schwester fährt Martha fort, zum Ballett vielleicht. Ihr Mann ist auch unterwegs. Ich bleibe bei Vater, streichelnd, Hand haltend, erzählend, das Buch habe ich längst zur Seite gelegt.
Das Röcheln kippt, der Atem schnappt leise. Dann setzt das Röcheln wieder ein. Dann schnappt der Atem wieder. Vorsichtig streichele ich seine Stirn, seine Schultern, weinend sage ich wie sehr wir ihn alle lieben, wie dankbar wir sind mit ihm gelebt zu haben. Sage die Namen der „wir“. Weine, streichele, der Atem schnappt und setzt immer öfter und länger aus. Ich spreche ein Vater unser und halte seine Hand. Irgendwann ist es der letzte Atemzug, der Mund und die Augen sind offen, in eine Ferne gerichtet die nicht mehr meine ist. Ich weine und streichele weiter. Vater Vater. Es ist kurz nach fünf Uhr nachmittags.
Ich rufe Frau G. an, frage sie, wie ich ihm Mund und Augen schließe – es war mir nicht gelungen.
Dann kommt meine 15jährige Nichte Anna die Treppe herunter, ich gehe ihr entgegen und ich sage ihr dass ihr Großvater gerade gestorben ist. Sie geht zu ihm. Dann kommen sie bald alle. Meine Freundin, meine Schwester, ihr Mann und deren drei Kinder, mein Bruder.
Frau G. kommt auch und richtet nicht nur Mund und Augen sondern legt ihn auch so hin, dass er gerade liegt und ganz entspannt aussieht.
Wir rufen den Bestatter an und vereinbaren ein Abholen der Leiche am nächsten Abend, einem Sonntag. So haben wir noch Zeit zur Verabschiedung.
Dann rufen wir den ärztlichen Notdienst an. Es ist inzwischen acht Uhr abends. Meine Schwester, ihr Mann und ich warten neben Vater auf den Arzt. Wir sind erschöpft und müde, doch wir müssen warten bis kurz vor Mitternacht. Der Arzt und sein jugendlicher Helfer sind wie aus einer anderen Galaxie. Unsicher rattert der Arzt seinen Fragebogen herunter und weiß nicht wie das Formular auszufüllen ist. Dann untersucht er Vater, aber ob das mehr ist als vorgeschriebene Routine bezweifele ich – er sieht nicht aus als würde er wissen was er bei einem Verdacht auf Gewalt tun würde. Seine Fragen nach Krankheit, Werdegang wirken auf mich deplaziert, medizinisch steril. Der Helfer kaut Kaugummi und schaut den Toten nicht an. Die beiden diskutieren schier endlos über das richtige Ausfüllen des Totenscheines (und machen es am Ende doch falsch, so dass der Bestatter einen neuen anfordern muss). Schließlich sind diese Außerirdischen auch verschwunden. Wir gehen schlafen.
Am nächsten Tag kommen Vaters Schwester, Mutters Schwestern, die Söhne meines Bruders. Wir drei Geschwister, die Kinder, meine Freundin und der Mann meiner Schwester nehmen einen letzten Abschied in einer Runde um den Toten als der Bestatter kommt. Du warst ein guter Vater sagt mein Bruder. Dann wird der tote Vater fortgebracht.
veröffentlicht in: Dr. med. Mabuse September/ Oktober 2006